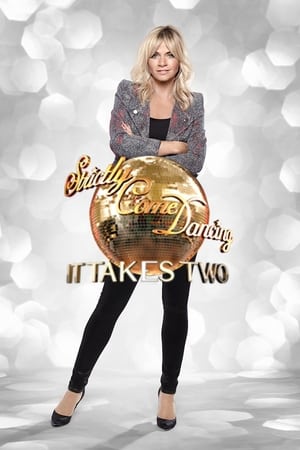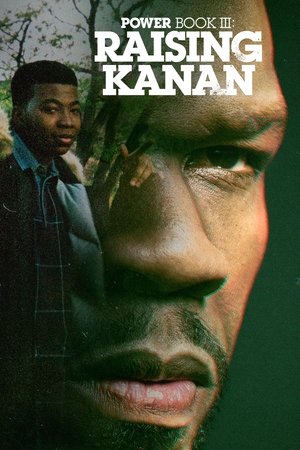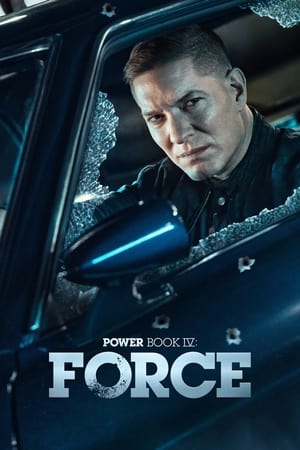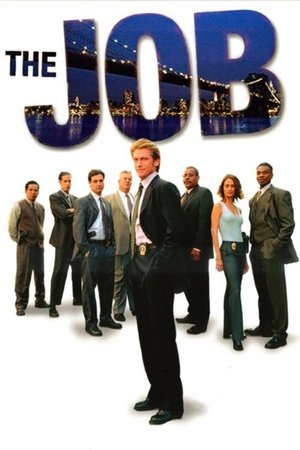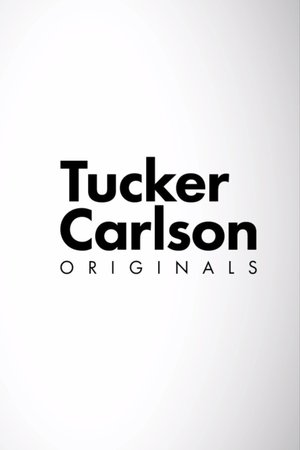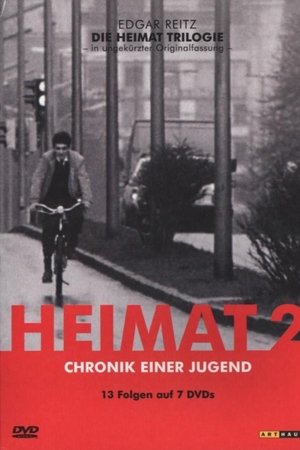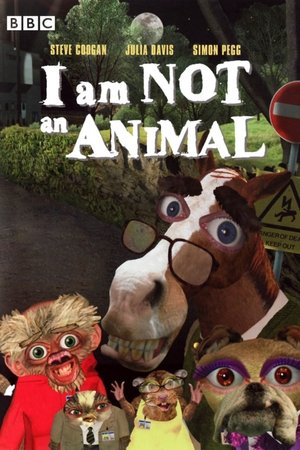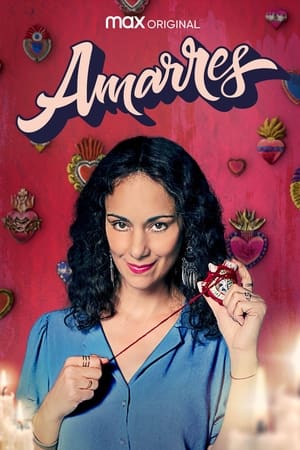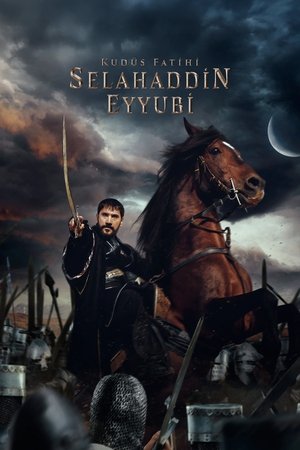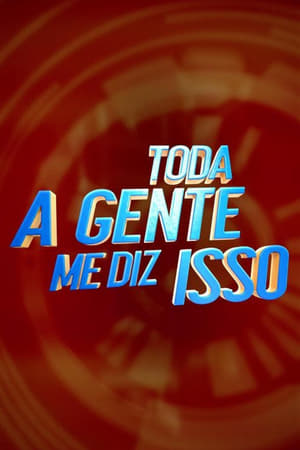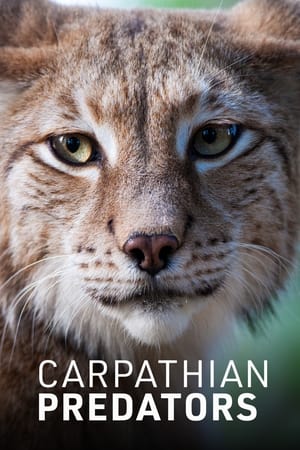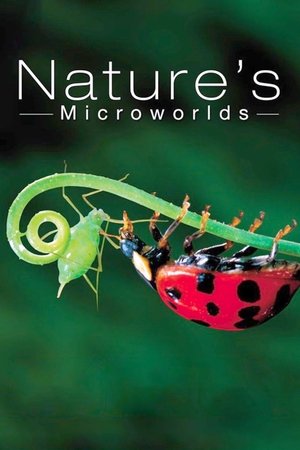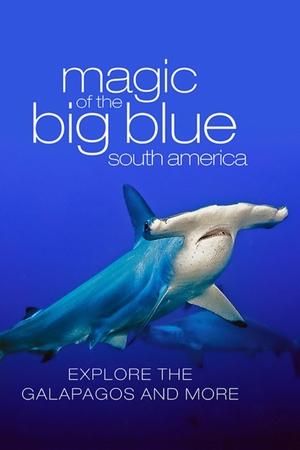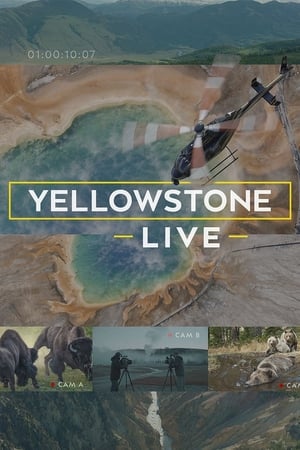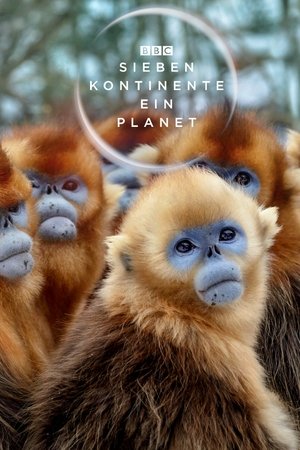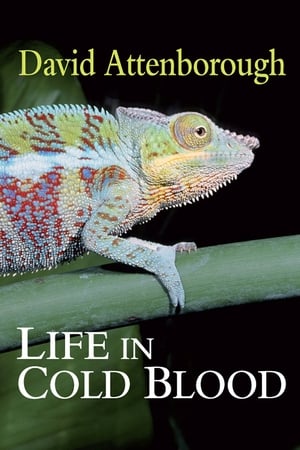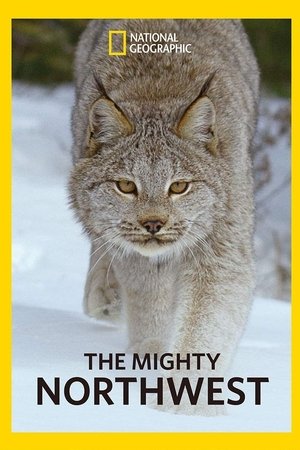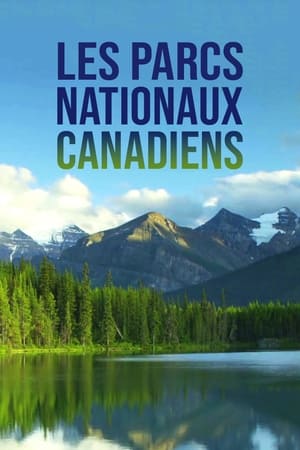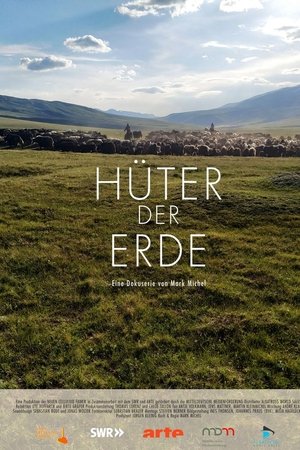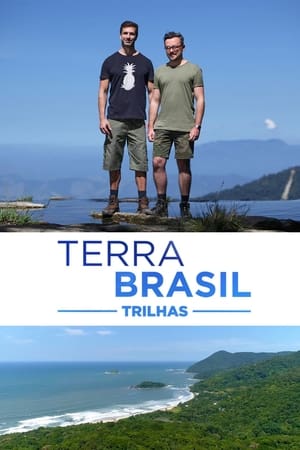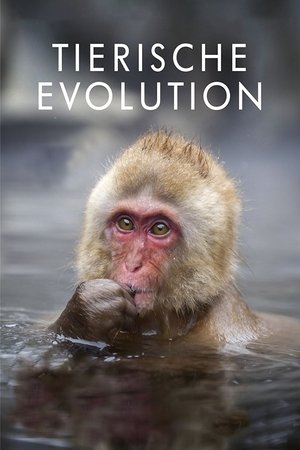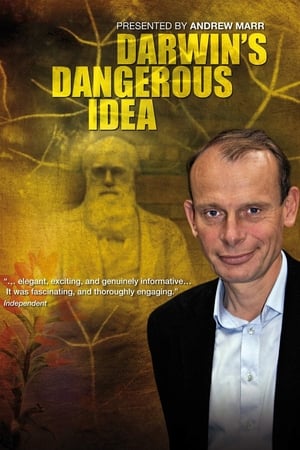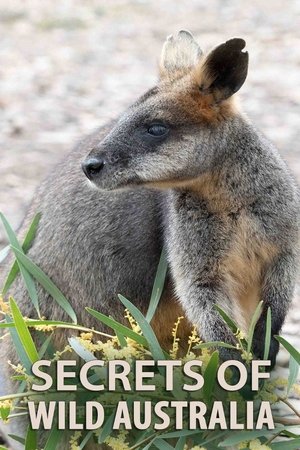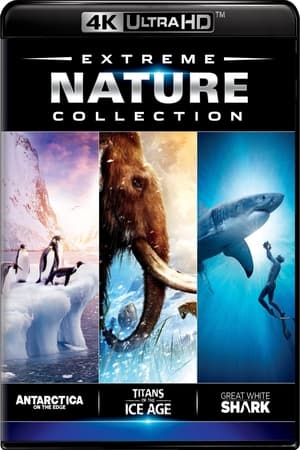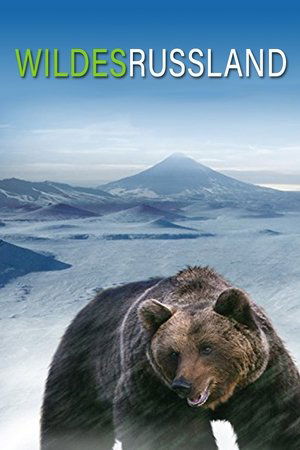Menschen gegen Monster - Der Kampf um unseren Planeten
Menschen gegen Monster ist eine Naturdokumentation, welche 2003 von der BBC veröffentlicht wurde. Das zentrale Thema der Dokumentation ist das große Artensterben vieler Großtiere während des Endes des Pleistozäns und des Mittelalters in Amerika, Australien und Neuseeland. 2003 wurde die Dokumentation in Großbritannien erstmals ausgestrahlt, die deutsche Erstausstrahlung fand am 27. November 2003 auf NDR statt. Ähnlich wie bei der Serie Wildes Amerika – Zeugen der Eiszeit, welche 2002 erschien, wurden in der Dokumentation ausgestorbene Großtiere entweder durch CGI (z. B. Kurznasenbär) oder durch Live-Acting dargestellt (z. B. Amerikanischer Löwe).
Besetzung
Crew
Folgen

Staffel 1
8. April 2003Die aufwändige dreiteilige BBC-Produktion „Menschen gegen Monster“ führt zurück in eine außergewöhnliche Phase der Menschheit: Die Ausbreitung des Homo Sapiens auf neue Erdteile. Im ersten Teil folgen die Autoren den Vorfahren der Indianer nach Amerika, im zweiten und dritten den Aborigines und Maoris nach Australien und Neuseeland. Oft standen die Menschen den gefährlichsten Raubtieren ihrer Zeit Auge in Auge gegenüber: Giganten, die heute längst ausgestorben sind, viele von ihnen kaum bekannt. Diese Tiere werden mit aufwändigen Computeranimationen zum Leben erweckt. Im Zentrum der Filme stehen jedoch die Entdeckerfamilien. Die Dokumentation verfolgt ihr Schicksal in Spielfilmqualität hautnah.
Die aufwändige dreiteilige BBC-Produktion „Menschen gegen Monster“ führt zurück in eine außergewöhnliche Phase der Menschheit: Die Ausbreitung des Homo Sapiens auf neue Erdteile. Im ersten Teil folgen die Autoren den Vorfahren der Indianer nach Amerika, im zweiten und dritten den Aborigines und Maoris nach Australien und Neuseeland. Oft standen die Menschen den gefährlichsten Raubtieren ihrer Zeit Auge in Auge gegenüber: Giganten, die heute längst ausgestorben sind, viele von ihnen kaum bekannt. Diese Tiere werden mit aufwändigen Computeranimationen zum Leben erweckt. Im Zentrum der Filme stehen jedoch die Entdeckerfamilien. Die Dokumentation verfolgt ihr Schicksal in Spielfilmqualität hautnah.

Kampf um Amerika (1)
Als die Menschheit vor vielen tausend Jahren nach Amerika gelangte, war es Winter, tiefster Winter – so die gängige Theorie. Eine Eiszeit soll vor 11.000 bis 15.000 Jahren steinzeitlichen Jägern und Sammlern aus Asien ermöglicht haben, trockenen Fußes über die Beringstraße nach Amerika zu gelangen. Vielleicht waren es sibirische Jäger bei der Verfolgung von Mammuts – niemand weiß so genau, wie es am Ende des Pleistozäns dazu kam. Was man weiß: Fast ein Drittel der Erdkugel war damals von Eis bedeckt, auch die Beringstraße zwischen Asien und Amerika.

Kampf um Australien (2)
Der Namen, den die Engländer den „Aborigines“ – lateinisch „ab origine“: „von Beginn an“ – gaben, ist sachlich nicht ganz richtig. „Von Beginn an“ waren die „Aborigines“ nicht auf der Insel. Auch sie waren Einwanderer, die nur schon „etwas“ früher nach Australien kamen. Vor ungefähr 65.000 bis 55.000 Jahren erreichen die ersten Menschen australischen Boden. Über die indonesische Timor-See kommend landeten sie im Norden des Kontinents – einem Erdteil, der seit 40 Millionen Jahren vom Rest der Welt isoliert war. Dichter, trockener Dschungel empfing die ersten Siedler.

Kampf um Neuseeland (3)
Um das Jahr 1200 wird Neuseeland von polynesischen Seefahrern entdeckt. Sie betreten das letzte ‚Paradies‘ der Erde. Ungestört von Säugetieren konnten sich hier die größten Vögel aller Zeit entwickeln – die Moas. Die Drei-Meter-Riesen sind harmlose Pflanzenfresser. Doch in den Bäumen lauert der gigantische Neuseeland-Adler Hapargornis. Er ist ein Moajäger und macht keinen Unterschied zwischen befiederten und unbefiederten Zweibeinern. Einige der neuen Einwohner Neuseelands fallen ihm zum Opfer. Allerdings sind Riesenvögel den frühen Maoris schutzlos ausgeliefert: Sie brennen große Waldgebiete ab und rotten in nur 160 Jahren Moas und Riesenadler aus. Die Folge sind schwere Hungersnöte.
Bilder
Empfohlene Serien
Ähnliche Serien
| Ursprungsland | GB |
| Original Sprache | en |
| Produktionsländer | United Kingdom, Germany |
| Produktionsfirmen | BBC Two(GB) |
| Produktionsfirmen | BBC(GB), NDR Naturfilm(DE) |